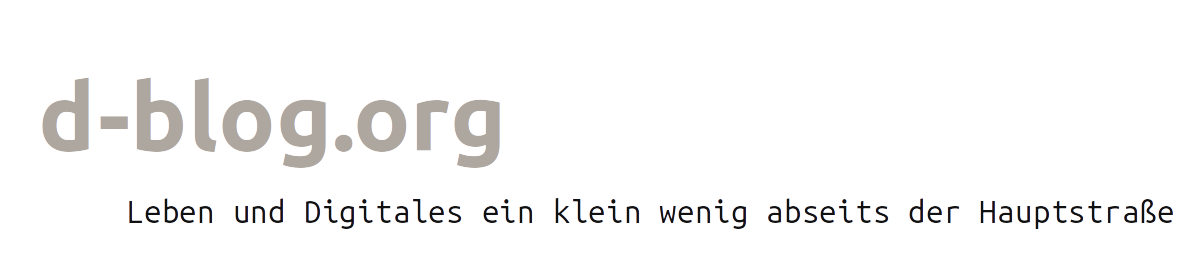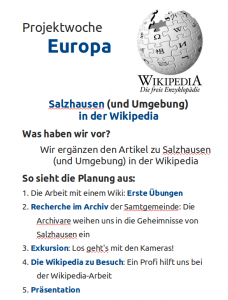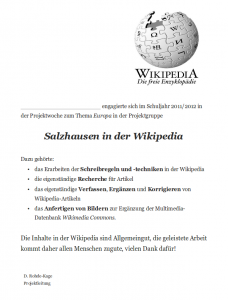Hat man sich durch den ersten Teil des Blog-Artikels von den Vorteilen eines Wikis überzeugen lassen und ein Mediawiki eingerichtet, soll es hier darum gehen, wie man dieses Wiki sinnvoll in den Unterricht einbinden kann. Ich schildere hier die Erfahrungen aus einer Projektwoche zum Thema ‚Europa‘ an meiner Schule. Projekttitel war : „S. und Umgebung in der Wikipedia“
Ein eigenes Wiki gegen den Relevanzkriterien-Hammer
Vorher stellte sich die Grundsatz-Frage: Ist es überhaupt möglich, mit SchülerInnen der Sekundarstufe I sinnvoll an der Wikipedia zu arbeiten? Die Frage wurde beantwortet, als sich ein sehr engagierter Wikipedianer als Legastheniker outete. Damit wurde deutlich, welche kooperativen Möglichkeiten ein Wiki bietet: Jeder bringt seine Stärken ein, die Gruppe korrigiert und formt das Ganze.
Es ist ein wichtiger pädagogischer Grund, der trotzdem für ein eigenes Wiki und gegen die direkte Arbeit an der Wikipedia spricht: Wer in der Wikipedia jemals einen Artikel neu geschrieben hat, kennt vielleicht den Frust, wenn nach zwei Stunden der Artikel ‚aus Relevanzgründen‘ wieder gelöscht wurde.
Offtopic: Es folgt hier ein klares, polemisches Statement in der Diskussion um Relevanzkriterien: Sie gehören abgeschafft. In einem Artikel ist ein Sachverhalt gut beschrieben und die Belege sind unzweifelhaft. Dann hat nach meiner Auffassung auch die Eselsmütze, die Palmenspinne und selbst Lena (hieß die so?) einen Artikel verdient. Es erinnert an die Unsitte, dass wissenschaftliche AutorInnen durch verklausulierte Sprache ihren elitären Status meinen sichern zu müssen. Die Relevanz ergibt sich möglicherweise für andere Menschen zu einer anderen Zeit, und die Selektion nach Relevanz erscheint mir mindestens als ungute Besserwisserei.Es gibt die Relevanzkriterien der Wikipedia. Und die Arbeit von SchülerInnen muss in jedem Fall gewürdigt werden und darf nicht durch einen unsichtbaren Sichter zerstört werden. Und: Die Mediawiki-Formatierungen können mehr als in der Wikipedia gezeigt werden! Der Kompromiss lautet(e) also: Erst im Schulwiki arbeiten, dann die Inhalte in die Wikipedia.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Hier im Kleinen und hier im Großen!
Planung, Durchführung und Reflexion kurz und knapp
Aufbau der Projektreihe
Die Projektwoche lief fünf Tage und wurde mit einer öffentlichen Präsentation am letzten Projekttag beendet. Teilnehmer waren fünfzehn SchülerInnen der Klassenstufe 9. Die Linux-PC-Arbeitsplätze waren ständig verfügbar, es standen zehn Digitalkameras des Medienzentrums des Landkreises zur Verfügung. Der Dozent der Wikipedia wurde über die Wikimedia Deutschland in Berlin gefunden.
| Tag | Themen | Inhalte/Hinweise |
|
1 |
Die Arbeit mit einem Wiki: Verfassen von Artikeln |
|
|
2 |
Recherche im Archiv der Samtgemeinde S. |
|
|
3 |
Geführte Exkursion im Ort |
|
|
4 |
S. und Umgebung in den Artikeln der Wikipedia |
|
|
5 |
Präsentation |
|
Verbesserungswürdige Aspekte
- Die Hilfestellung des Wikipedianers war großartig, die theoretische Einführungs-Präsentation aber zu wenig auf SchülerInnen abgestimmt. Vorschlag: Loslegen mit der Arbeit an der Profilseite. Wichtige Aspekte zur fotografischen Dokumentation vermitteln (Persönlichkeitsrechte, fotografische Arbeitsweisen/Tricks usw.). Sachliche Infos zur Wikipedia finden später noch ihren Platz.
- Die Wikipedianer-Gemeinschaft ist wie viele Open-Source-Communities lebendig und international. Wie kann das, außer in einem englischsprachigen Film, vermittelt werden?
- Das Wikimedia-Schulprojekt vermittelt (nicht mehr! Stand Jan. 2020) DozentInnen, die in der Regel mit rund 150€ abgerechnet werden. Dieser Betrag ist verständlich, weil auch die Wikimedia-Stiftung Ausgaben wie Fahrtkosten für die DozentInnen bestreiten muss. SchülerInnen war dies schwer zu vermitteln: Sie bringen sich ein und werden dann aufgefordert, etwas zu zahlen. Wie kann das anders organisiert werden?
Noch einmal? Sofort!
- Die Arbeit an einem Artikel über die eigene Heimat wurde großartig aufgenommen.
- Es ergab sich eine hohe Eigenständigkeit: Die SchülerInnen bestimmten selber Ihre Arbeitsanteile an der fotografischen Dokumentation, der Recherche im Archiv und der Ausarbeitung der Artikel.
- Die Wikipedia wurde – abseits von den bemerkenswerten Fakten – verstanden!
- Die Arbeit hat durch ihre Aktualität einen hohen Aufforderungscharakter, der Umgang mit digitalen (Online-)Medien ist zeitgemäß.
- Das Kopieren aus fremden Texten (hier: Ortsbiographien) wurde als problematisch erkannt: Eine lebhafte Diskussion um das Urheberrecht entbrannte.
- Der Stoff geht so gut wie nie aus: Mit der Arbeit an einem Artikel zur eigenen Heimat öffnet man so viele Inhalte, dass es auch eine Jahresprojektarbeit bzw. AG gestalten könnte. Die Querverknüpfungen führen ins Unendliche.
Zum Abschluss: Die Anerkennung für die SchülerInnen
Die Mediawiki-Stiftung hat (offenbar) keine standardisierte Teilnahme-Urkunde für neue AutorInnen. Eine Anerkennung für die SchülerInnen ist gleichzeitig immer auch Werbung, insofern wurde eine Anerkennung gestaltet, die mit den Zeugnissen überreicht wurde.